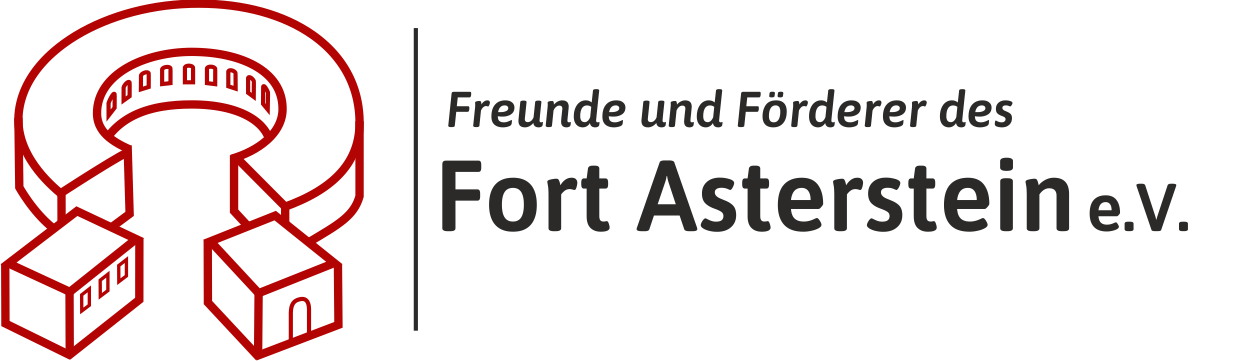Kurze Geschichte der Entstehungszeit
Koblenz, Preußen und die Festungsanlagen
In dieser kurzen Übersicht geht es um die geschichtliche Entwicklung von Koblenz im 19. Jahrhundert und beleuchtet wird insbesondere die Rolle der Stadt als preußische Festung. Die Ereignisse beginnen mit der Befreiung von Koblenz durch russische Truppen in der Neujahrsnacht 1813/1814, eine Phase, die sowohl militärische als auch rechtliche Veränderungen mit sich brachte. Nach der siegreichen Völkerschlacht bei Leipzig einigten sich die alliierten Mächte auf die sogenannte Leipziger Konvention, die die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit bildete. Zu den wichtigen Maßnahmen gehörte die Einrichtung einer Zentralverwaltung für die besetzten napoleonischen Gebiete mit Sitz in Frankfurt, unter der Leitung des preußischen Reformers Karl Freiherr vom und zum Stein.
Die Verwaltung von Koblenz und Umgebung wurde neu organisiert, und 1816 entstand der Stadtkreis Koblenz, zu dem neben der Stadt auch benachbarte Gemeinden wie Ehrenbreitstein, Neuendorf und Karthause gehörten. Gleichzeitig existierte ein Landkreis Koblenz, der weiter entfernte Bürgermeistereien wie Bassenheim, Rhens und Dieblich umfasste. Diese Verwaltungseinheiten wurden jedoch bereits ein Jahr später zusammengelegt. Die Reformen setzten sich fort, und 1822 wurde Koblenz zur Provinzhauptstadt des Großherzogtums Niederrhein, das später mit der Provinz Jülich-Kleve-Berg zusammengeführt wurde.
Eine entscheidende Entwicklung in der Geschichte der Stadt war der Bau der Festung Koblenz-Ehrenbreitstein, der im Frühjahr 1815 begann und bis 1834 andauerte. Die Errichtung der Festung stellte eine enorme Belastung für die lokale Bevölkerung dar, da viele Männer zwangsweise rekrutiert wurden. Sie erhielten nur geringe Entlohnung, während die Stadt Koblenz oft zusätzlich für die Kosten aufkommen musste. Die Arbeiten wurden von einer Festungsbaukommission organisiert, der sowohl Ingenieuroffiziere als auch zivile Experten angehörten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Festung nicht nach den klassischen Prinzipien der Renaissance oder des Barock geplant wurde, sondern sich strikt an die topografischen Gegebenheiten anpasste. Es entstand ein System voneinander unabhängiger Verteidigungsanlagen, das nicht nur das Mittelrheintal schützte, sondern auch die einzelnen Teile gegenseitig absicherte.
Die Festung bestand aus sechs Hauptsystemen, darunter Ober- und Niederehrenbreitstein, Pfaffendorfer Höhe mit dem Fort Asterstein und Fort Alexander. Sie wurde aus regionalen Materialien wie Bruchstein und Sandstein errichtet, was die Baukosten reduzierte. Trotz ihrer innovativen Architektur und ihrer strategischen Bedeutung stellte die Festung jedoch auch ein Symbol für die preußische Herrschaft dar. Sie war Ausdruck des imperialen Anspruchs der neuen Landesherren und diente als klares Signal an Frankreich.
Die Festung Koblenz-Ehrenbreitstein wurde bereits von Zeitgenossen bewundert und sorgte für großes internationales Interesse. Zahlreiche Offiziere des Deutschen Bundes sowie Vertreter anderer Nationen besichtigten die Baustelle. Die Leitung der Arbeiten oblag mehreren Ingenieuren, wobei Ernst Ludwig von Aster, ein preußischer General, oft fälschlicherweise als alleiniger Urheber betrachtet wird. Neben den Ingenieuren trugen auch zivile Experten wie der Baumeister Johann Claudius von Lassaulx zur Realisierung des Projekts bei.
Nach der Fertigstellung der Festungsanlagen im Jahr 1834 wurden weitere Modernisierungen notwendig, da der technische Fortschritt und der Bau der Eisenbahn neue Herausforderungen mit sich brachten. Die Gesamtfestung erfüllte jedoch nicht mehr die Anforderungen der Zeit und hemmte zudem die städtische Entwicklung. Daher wurde ab dem späten 19. Jahrhundert der Befestigungsring, der die Innenstadt umschloss, schrittweise aufgegeben. Andere Teile der Festung, wie die Feste Ehrenbreitstein, blieben jedoch weiterhin in militärischer Nutzung. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verloren sie ihre strategische Bedeutung.
Insgesamt zeigt sich, wie eng die Geschichte von Koblenz mit der napoleonischen und der preußischen Herrschaft sowie dem Bau der Festung verbunden ist. Die Festung ist ein Symbol für militärische Innovation, aber auch für die Belastungen, die diese Entwicklungen für die Bevölkerung mit sich brachten. Bis heute prägt sie das Stadtbild und erinnert an die historischen Umbrüche und Herausforderungen des 19. Jahrhunderts.

Gesamtdarstellung der Festung Koblenz
Dies ist die Darstellung zum Jubiläum 2017. Der Textteil ist nicht mehr aktuell und wir hier bald ersetzt – dient also jetzt nur der Anschauung.

Astersteiner Teil einer Gesamtkarte der Koblenzer Befestigungen
Fort Asterstein Kartenausschnitt aus einer im Original vierteiligen Karte aus dem Stadtarchiv Koblenz. StAK K Nr. 248 –

Eine der umfangreichsten Darstellungen zu den Koblener Festungen, natürlich auch des Fort Asterstein.
Mit dieser Schrift ist der wissenschaftliche Einstieg in die Koblenzer Festungsgeschichte (auf fast 600 Seiten) seit der Römerzeit sehr gut möglich.